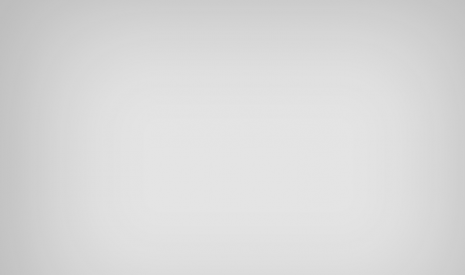Österreichische Gesellschaft für
Ur- und Frühgeschichte
Herzlich Willkommen!
Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF) ist ein gemeinnütziger
wissenschaftlicher Verein, der sich seit der Gründung 1950 der Förderung der Erforschung
der Ur- und Frühgeschichte sowie verwandter bzw. benachbarter Forschungsgebiete
– insbesondere in Österreich – widmet.
Mit rund 1000 Mitgliedern – FachkollegInnen ebenso wie allgemein an Archäologie Interessierten
– ist die ÖGUF zudem die größte archäologische Gesellschaft Österreichs.
Weihnachtspause
Wir haben von 24. Dezember 2025 bis inklusive 1. Jänner 2026 Weihnachtspause. Ab 2. Jänner 2026 sind wir wieder per Mail für Sie erreichbar.
Das ÖGUF Büro öffnet wieder am 12. Jänner 2026 (zusätzlich geschlossen: 22. Dezember 2025 und 5. Jänner 2026).
Wir wünschen frohe Weihnachten uns einen guten Rutsch ins neue Jahr!
ÖGUF- Weihnachtsaktion
Für alle, die noch ÖGUF-Mitglied werden wollen, haben wir jetzt eine tolle Weihnachtsaktion. Noch diesen Monat Mitglied werden und:
- den Mitgliedsbeitrag für 2025 geschenkt bekommen
- die AÖ 35/2024 gratis erhalten
- erst den Mitgliedsbeitrag für 2026 zahlen
Hier klicken, um Mitglied zu werden.
Depotabverkauf
Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für die archäologisch interessierte Familie bzw. Freunde? Peinliche Lücken in der AÖ-Sammlung? Keine Angst, wir helfen Ihnen!
Weihnachts-Depotabverkauf exklusiv für ÖGUF-Mitglieder: Wir bieten Altbestände der Archäologie Österreichs (AÖ) sowie weitere archäologische Fachliteratur zu stark reduzierten Preisen an.
Mehr Infos und die aktuellen Preise finden Sie hier:
Stand: Dienstag, 09. Dezember 2025
ÖGUF Junior Scientist Poster Award 2025 - Publikumspreis
Bis 21. Dezember 2025 haben Sie die Möglichkeit für das Poster Ihrer Wahl abzustimmen. Den Link zur Abstimmung finden Sie hier. Alle Poster sind in der Aula des Archäologiezentrums der Universität Wien (Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien) ausgestellt. Der/Die Gewinner:in des Publikumspreises erhält Bücherpreise der ÖGUF.
Veranstaltungsblatt WS 2025/26
Das aktuelle Veranstaltungsblatt für das WS 2025/26 ist da:
Stand: Mittwoch, 01. Oktober 2025
Aktuelles
Januar 2026
Ziele der ÖGUF
Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF), deren Tätigkeit gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Förderung der Erforschung der Ur- und Frühgeschichte, Mittelalter- und Neuzeitarchäologie und verwandter bzw. benachbarter Forschungsgebiete – insbesondere in Österreich.
Ideelle Mittel
- Enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verwandten bzw. benachbarten Fachdisziplinen.
- Fachwissenschaftliche Veranstaltungen (insbesondere Vorträge, ÖGUF-Symposien, Tagungen, Exkursionen, Führungen, Workshops, Seminare, Präsentationen, Praktika, Schulungen und Lehrveranstaltungen zur fachwissenschaftlichen Erwachsenenbildung und Nachwuchsförderung).
- Herausgabe und Verbreitung fachwissenschaftlicher Publikationen und Dokumentationen (wie etwa Archäologie Österreichs bzw. Archäologie Österreichs Spezial).
- Durchführung von fachwissenschaftlichen Forschungen und Projekten.
- Anlegung und Verwaltung einer Fachbibliothek (ÖGUF-Bibliothek) und einschlägiger fachwissenschaftlicher Datenbanken.
- Durchführung sonstiger fachwissenschaftlicher Tätigkeiten in den einschlägigen Fachgebieten und Fachdisziplinen.
Die erforderlichen materiellen Mittel werden hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge sowie durch Erträge aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen, vereinseigene Aktivitäten, Spenden, Subventionen und sonstige fachwissenschaftlich begründete Einnahmen (z. B. ÖGUF-Bücherbasar) aufgebracht
Zentrale Anliegen
- Aktive und intensive Nachwuchsförderung im Bereich Archäologie.
- Fundierte fachwissenschaftliche Erwachsenenbildung zur Archäologie Österreichs.
- Rasche Information zur Archäologie Österreichs mit Hilfe mehrerer Medien.
- Plattform für einen fachwissenschaftlichen Austausch.
- Wissenschaftliche Kontaktpflege zwischen Fachkolleg:innen, Studierenden und den an der Archäologie Interessierten.
- Vermittlung preisgünstiger archäologischer Publikationen.
-
Fokussierung auf Top-Themen in der Archäologie Österreichs.
ÖGUF-Team
Das ÖGUF-Office ist für Sie erreichbar:
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
c/o Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie
der Universität Wien
Franz-Klein-Gasse 1
A-1190 Wien
Tel.: +43 1 4277-40477 (Office)
Homepage: www.oeguf.ac.at
E-Mail: office@oeguf.ac.at
Mitgliedswesen – Kassabelange – Publikationsbestellungen:
Kayleigh Saunderson, BA MA
Büro-Öffnungszeiten: Montag, 9:00-12:00 Uhr
(ausgenommen vorlesungsfreie Zeit und Feiertage)
E-Mail: office@oeguf.ac.at
Tel.: +43 1 4277-40477
Vorstand:
Mag. Dr. Michaela Binder
E-Mail: vorsitz@oeguf.ac.at
E-Mail privat: binder@novetus.at
Tel.: +43 676 3946714
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb
E-Mail: alexandra.krenn-leeb@univie.ac.at
Mobil: +43 664 1848222
Arbeitskreiskoordination – Veranstaltungsblatt
Archäologie
Szene Österreichs:
Nicolas Loy, BA BA
E-Mail: nicolas.loy@gmx.at
Mobil: +43 676 5269430
Redaktionsteam Archäologie Österreichs:
Martin Gamon, BA MA
Mag. Ulrike Schuh
Tabea Truntschnig, BA MA
Armin Schwaiger, BA
E-Mail: redaktion@oeguf.ac.at
Stv. Geschäftsführung:
Martin Gamon, BA MA
E-Mail: martin_gamon@gmx.at
Nicolas Loy, BA BA
E-Mail: nicolas.loy@gmx.at
Mobil: +43 676 5269430
Schriftleitung Archäologie Österreichs Spezial:
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb
E-Mail: alexandra.krenn-leeb@univie.ac.at
Mobil: +43 664 1848222